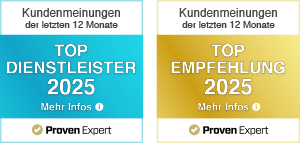Private Krankenversicherung Elternzeit – das gilt
Waren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor der Geburt ihres Kindes privat krankenversichert, bleibt dieser Versicherungsschutz auch während der Elternzeit bestehen. Allerdings entfällt für angestellte Privatversicherte der Arbeitgeberzuschuss in dieser Zeit. Welche weiteren Regelungen für die private Krankenversicherung in der Elternzeit gelten, wie sich das Elterngeld gestaltet und wie es im Mutterschutz aussieht, erfährst du in diesem Experten-Artikel.
💡 Wichtige Infos auf einen Blick
- Werdende Eltern müssen zwischen Mutterschutz, Elternzeit und Elterngeld unterscheiden.
- Die private Krankenversicherung muss während der maximal 3-jährigen Elternzeit ganz normal weitergezahlt werden. Bei Angestellten entfällt der Arbeitgeberzuschuss.
- In der Elternzeit besteht ein Anspruch auf Elterngeld für maximal 14 Monate. Das maximale Elterngeld beträgt 1.800 Euro pro Monat, die Mindesthöhe liegt bei monatlich 300 Euro.
- Während der Elternzeit kann man erst von der PKV in die GKV wechseln, wenn man wieder in Teilzeit arbeitet.
- Der Mutterschutz ist ein Versicherungsfall für das Krankentagegeld, sodass hier auch für Selbstständige in der Regel keine Einkommenslücke entsteht.
Auch im Video: Private Krankenversicherung Elternzeit
insgesamt über 2.400 positive Bewertungen bei Google und ProvenExpert
insgesamt über 2.400 positive Bewertungen bei Google und ProvenExpert










Versicherungen mit Kopf - Bekannt aus
Mutterschutz und Elternzeit – zwei Schutzregelungen für Eltern
Mutterschutz und Elternzeit sind zwei eigenständige, aber aufeinander abgestimmte rechtliche Regelungen, die werdenden und frischgebackenen Eltern wichtige Schutz- und Unterstützungsmaßnahmen bieten.
Während der Mutterschutz in erster Linie dem gesundheitlichen Schutz von Mutter und Kind dient, ermöglicht die Elternzeit beiden Elternteilen eine berufliche Auszeit zur Betreuung des Kindes.
Mutterschutz
Ziel
Der Mutterschutz schützt die Gesundheit von Mutter und Kind während der Schwangerschaft sowie in den ersten Wochen nach der Geburt. Er soll sicherstellen, dass werdende Mütter in dieser sensiblen Phase keinem gesundheitlichen Risiko durch ihre Arbeit ausgesetzt sind.
Dauer
Der Mutterschutz umfasst in der Regel einen Zeitraum von 6 Wochen vor dem errechneten Geburtstermin und 8 Wochen nach der Geburt. Bei Früh- oder Mehrlingsgeburten verlängert sich die Schutzfrist nach der Geburt auf 12 Wochen.
Leistungen
Während des Mutterschutzes erhalten gesetzlich krankenversicherte Arbeitnehmerinnen Mutterschaftsgeld in Höhe des durchschnittlichen Nettolohns der letzten 3 Monate, maximal aber 13 Euro pro Tag sowie einen Zuschuss des Arbeitgebers, um mögliche Einkommensverluste auszugleichen, die durch das Beschäftigungsverbot entstehen. Du bekommst in dieser Zeit das gleiche Geld wie vorher.
Privat krankenversicherte Arbeitnehmerinnen erhalten eine Einmalzahlung in Höhe von maximal 210 Euro vom Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) als Mutterschaftsgeld. Auch diese Zahlung wird vom Arbeitgeber aufgestockt. Die PKV zahlt anders als die GKV kein Mutterschaftsgeld.
Rechtlicher Status
Der Mutterschutz ist gesetzlich geregelt. Während dieser Zeit besteht ein Beschäftigungsverbot, das heißt: Die Mutter darf nicht arbeiten, es besteht jedoch ein besonderer Kündigungsschutz.
Elternzeit
Ziel
Die Elternzeit soll Müttern und Vätern ermöglichen, sich intensiv um die Betreuung und Erziehung ihres Kindes zu kümmern, ohne dabei ihren Arbeitsplatz zu verlieren.
Dauer
Beide Elternteile können pro Kind bis zu 3 Jahre Elternzeit in Anspruch nehmen. Dabei wird die Zeit des Mutterschutzes auf die Elternzeit der Mutter angerechnet. Ein Teil der Elternzeit kann auch auf einen späteren Zeitraum, etwa bis zum vollendeten 8. Lebensjahr des Kindes, verschoben werden.
Leistungen
Während der Elternzeit erhalten Eltern kein Gehalt vom Arbeitgeber, können jedoch Elterngeld beantragen – eine staatliche Leistung, die Einkommensverluste teilweise ausgleicht.
Elterngeld kann für einen Zeitraum von bis zu 14 Monaten in Anspruch genommen werden, wobei die Eltern die Aufteilung untereinander frei gestalten können. Dabei steht jedem Elternteil ein Mindestanspruch von 2 und maximal 12 Monaten zu. Das Basiselterngeld muss innerhalb der ersten 14 Lebensmonate des Kindes bezogen werden.
Das Elterngeld richtet sich nach dem Nettoeinkommen des betreuenden Elternteils vor der Geburt des Kindes, das während der Elternzeit nicht mehr erzielt wird. In der Regel beträgt das Elterngeld 65% dieses wegfallenden Einkommens, wobei es eine Höchstgrenze von 1.800 Euro gibt. Die Mindesthöhe liegt bei 300 Euro.
Neben dem Elterngeld gibt es noch das Elterngeld Plus, welches für bis zu 28 Monate in Anspruch genommen werden kann. Die Höhe liegt bei der Hälfte des normalen Elterngeldes.
Rechtlicher Status
Während der Elternzeit besteht ein Anspruch auf unbezahlte Freistellung von der Arbeit. Es gibt jedoch keinen gesetzlichen Anspruch auf Fortzahlung des Gehalts – die finanzielle Unterstützung erfolgt durch das Elterngeld.
Hauptunterschiede im Überblick
Der Mutterschutz ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Beschäftigungsverbot, das dem Schutz von Mutter und Kind vor und nach der Geburt dient. Die Elternzeit hingegen ist eine freiwillige berufliche Auszeit, die beiden Eltern offensteht und der familiären Betreuung und Erziehung des Kindes dient.
Während der Mutterschutz fest befristet und unmittelbar an die Geburt gebunden ist, kann die Elternzeit flexibel bis zum 3. Geburtstag des Kindes – und teilweise darüber hinaus – genommen werden. Zudem liegt der Fokus des Mutterschutzes auf dem gesundheitlichen Schutz, während die Elternzeit auf die aktive Mitgestaltung der ersten Lebensjahre des Kindes ausgerichtet ist.
Private Krankenversicherung Elternzeit Beiträge
Beiträge zur privaten Krankenversicherung (PKV) müssen während der Elternzeit in voller Höhe weitergezahlt werden – es sei denn, der gewählte Tarif sieht eine abweichende Regelung vor.
Da während dieser Zeit in der Regel kein Einkommen aus Erwerbstätigkeit erzielt wird, entfällt auch der Arbeitgeberzuschuss zur Kranken- und Pflegeversicherung.
Während der Elternzeit ist es grundsätzlich erst möglich, von der privaten in die gesetzliche Krankenversicherung zu wechseln, wenn man wieder in Teilzeit arbeitet.
Wechsel in GKV ist nach der Elternzeit möglich
Liegt das Einkommen nach der Elternzeit unterhalb der Versicherungspflichtgrenze, besteht grundsätzlich eine Pflicht zur gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) – unabhängig davon, ob während der Elternzeit eine gesetzliche oder private Absicherung bestand.
Im Gegensatz zur PKV müssen in der GKV während der Elternzeit keine Beiträge gezahlt werden. Dies gilt für Pflichtversicherte, nicht aber für freiwillig Versicherte.
Höheres Elterngeld kann private Krankenversicherungsbeiträge abfedern
Privatversicherte erhalten in der Regel ein etwas höheres Elterngeld, da der Staat bei der Berechnung keine pauschalen Abzüge für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge vornimmt.
Bei gesetzlich Versicherten wird hingegen eine Pauschale von 9% des Einkommens abgezogen.
Dadurch wird bei Privatversicherten ein höheres Nettoeinkommen zugrunde gelegt, was sich positiv auf die Höhe des Elterngeldes auswirkt und so die laufenden PKV-Kosten teilweise ausgleichen kann.
Arbeitgeberzuschuss des arbeitenden Ehepartners optimal nutzen
Wenn ein Ehepartner weiterhin in Vollzeit arbeitet und – ebenso wie der Elternteil in Elternzeit – privat krankenversichert ist, kann unter bestimmten Voraussetzungen der Arbeitgeberzuschuss zur privaten Krankenversicherung reduziert werden.
Voraussetzung dafür ist, dass der arbeitende Ehepartner die Höchstgrenze des möglichen Zuschusses noch nicht vollständig ausschöpft. In diesem Fall kann der Arbeitgeberzuschuss entsprechend angepasst und erhöht werden, sodass während des Bezugs von Elterngeld ein größerer Anteil der PKV-Kosten vom Arbeitgeber übernommen wird.
Private Krankenversicherung Elternzeit beitragsfrei
Die Beitragsbefreiung bei Elternzeit ist in immer mehr PKV-Tarifen zu finden.
In alten Tarifen galt diese oft nur, wenn gleichzeitig auch Elterngeld bezogen wurde. In neueren Tarifen greift die Beitragsbefreiung auch, wenn kein Anspruch auf Elterngeld besteht.
Was jedoch gleich geblieben ist, ist die Dauer der Befreiung. Diese beträgt bei allen Tarifen maximal 6 Monate.
Sprich uns gerne bei Bedarf in unserer Beratung zur privaten Krankenversicherung auf dieses Thema an.
insgesamt über 2.400 positive Bewertungen bei Google und ProvenExpert
Private Krankenversicherung Elternzeit Beamte
Beamte genießen in der privaten Krankenversicherung für Beamte im Vergleich zu anderen Versicherten besondere Vorteile.
Wie angestellte Eltern können auch sie während der Elternzeit Elterngeld beziehen, wobei ihre PKV-Mitgliedschaft bestehen bleibt.
70% Beihilfe in der Elternzeit
Im Gegensatz zum Arbeitgeberzuschuss entfällt die Beihilfe durch den Dienstherrn während der Elternzeit jedoch nicht – sie wird weiterhin gewährt und steigt sogar auf 70%. Dadurch sinken die PKV-Kosten für Beamte in der Elternzeit.
Zusätzlich besteht für Beamte unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, während der Elternzeit einen monatlichen Zuschuss in Höhe von bis zu 31 Euro zu den Beiträgen für Kranken- und Pflegeversicherung zu erhalten.
Ob ein Anspruch besteht und in welcher Höhe, hängt unter anderem vom jeweiligen Dienstherrn und der Besoldungsgruppe ab – der Anspruch gilt daher nicht pauschal für alle Beamten.
Private Krankenversicherung Mutterschutz
Der Verdienstausfall während des Mutterschutzes wird in der privaten Krankentagegeldversicherung als Leistungsfall gewertet.
Haben schwangere Versicherte ihre Police mindestens 8 Monate vor Beginn des Mutterschutzes abgeschlossen, zahlt der Versicherer das vertraglich vereinbarte Krankentagegeld aus.
Dies ist besonders für selbstständig tätige Frauen relevant, da sie weder Mutterschaftsgeld noch andere vergleichbare Leistungen erhalten.
Private Krankenversicherung Mutterschutz Angestellte
Bei privatversicherten Arbeitnehmerinnen fällt der Verdienstausgleich hingegen deutlich geringer aus. Hier wird lediglich die Differenz zwischen dem Mutterschaftsgeld des BAS und den 13 Euro pro Tag bzw. dem individuellen kalendertäglichen Nettolohn übernommen.
Infolgedessen wird die Auszahlung des Krankentagegeldes entsprechend auf diesen Differenzbetrag reduziert.
Während des Mutterschutzes wird jedoch kein Arbeitgeberzuschuss gezahlt.
Beispiel zur Berechnung des Krankentagegeldes während des Mutterschutzes
Die Mutterschutzfrist für Frau X umfasst insgesamt 99 Tage – bestehend aus 6 Wochen vor und 8 Wochen nach der Entbindung sowie dem Tag der Geburt.
Das Mutterschaftsgeld beträgt in ihrem Fall 210 Euro, was einem täglichen Betrag von 2,12 Euro (210 Euro / 99 Tage) entspricht.
Da der Arbeitgeber lediglich einen Zuschuss zum Gehalt leistet, der den Betrag von 13 Euro pro Tag übersteigt, entsteht für Frau X ein täglicher Einkommensverlust von 10,88 Euro (13 Euro – 2,12 Euro).
Dieser Differenzbetrag wird durch die Krankentagegeldversicherung übernommen.
Private Krankenversicherung Mutterschutz Beamte
Beamte erhalten während der Mutterschutzfristen ihre vollen Dienstbezüge und haben daher keinen Anspruch auf Mutterschaftsgeld im Sinne der gesetzlichen Krankenversicherung.
Sollte die Mutterschutzfrist jedoch in eine Elternzeit ohne Bezüge fallen, kann unter bestimmten Umständen ein Zuschuss zum Mutterschaftsgeld gewährt werden.
Was gilt bei Teilzeit während der Elternzeit?
Privatversicherte, die während der Elternzeit in Teilzeit arbeiten und dabei unterhalb der Versicherungspflichtgrenze verdienen, unterliegen grundsätzlich der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung. Es besteht jedoch die Möglichkeit, sich von dieser Pflicht befreien zu lassen.
Voraussetzung dafür ist, dass die wöchentliche Arbeitszeit im Durchschnitt maximal 32 Stunden beträgt (für Geburten vor dem 1. September 2021: 30 Stunden), oder dass die Teilzeitbeschäftigung der beruflichen Ausbildung dient bzw. in der Kindertagespflege maximal fünf Kinder betreut werden.
Die Befreiung gilt ausschließlich für die Dauer der Elternzeit – auch dann, wenn währenddessen der Arbeitgeber gewechselt wird.
Teilzeit nach der Elternzeit
Wird eine privatversicherte Person nach der Elternzeit durch eine Teilzeitbeschäftigung versicherungspflichtig, kann ebenfalls eine Befreiung beantragt werden – vorausgesetzt, sie arbeitet höchstens die Hälfte der regulären Arbeitszeit vergleichbarer Vollzeitkräfte im Betrieb und war in den letzten 5 Jahren aufgrund ihres Einkommens von der Versicherungspflicht befreit.
Dabei wird die Elternzeit auf die 5-Jahres-Frist angerechnet. Wichtig ist zudem, dass bei einer hypothetischen Vollzeitbeschäftigung das Einkommen über der aktuellen Versicherungspflichtgrenze liegen würde.
Ein Beispiel: Eine Arbeitnehmerin war 3 Jahre lang in Vollzeit privat versichert und nahm anschließend 2 Jahre Elternzeit. Bei Wiedereinstieg in Teilzeit kann sie sich von der gesetzlichen Versicherungspflicht befreien lassen.
insgesamt über 2.400 positive Bewertungen bei Google und ProvenExpert

insgesamt über 2.400 positive Bewertungen bei Google und ProvenExpert
Was Kunden über unsere Beratung sagen
Ähnliche Seiten